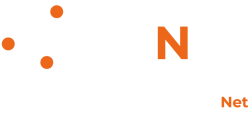Teststrecken
Faserteststrecken in QR.N:
In Deutschland existiert eine leistungsfähige Faserstrecken-Infrastruktur für Quantenkommunikation. Auf dieser Seite finden Sie bestehende oder geplante Forschungsaufbauten der QR.N-Projektpartner.
Innerhalb des Verbundprojekts QR.N stehen schon heute Teststrecken zur Verfügung, an denen verschiedene Quantenspeicher getestet und die für Demonstrationen und Experimente genutzt werden. Diese Verbindungen ermöglichen die Erprobung neuer Protokolle, Komponenten und Verfahren der Quantenkommunikation unter realen Bedingungen. Damit bilden sie eine wichtige Grundlage, um die Technologien schrittweise in Richtung zukünftiger Quantennetzwerke weiterzuentwickeln.

Legende:
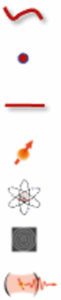
Faserteststrecke
Paarquelle / Detektor
Repeater Link im Labor
Diamant Quantenspeicher
Atom / Ionen Quantenspeicher
HL Quantenpunktemitter
Resonator-integrierter Speicher
Neben den bestehenden Faserstrecken gibt es im Rahmen der Initiative für den Aufbau eines bundesweiten Glasfasernetzes für Quantentechnologien sowie Zeit- und Frequenzsignale (engl. Time & Frequency, T&F) Bemühungen für die Einrichtung eines zusätzlichen, begrenzten und vom regulären Internet getrennten Glasfaser-Backbones. Dieses Netz soll in der kommenden Dekade für Forschung, Entwicklung und Anwendung in den Bereichen Quantenkommunikation und T&F‑Verteilung bereitstehen – unabhängig von den betrieblichen Anforderungen der klassischen Datenkommunikation.

Mögliche künftige Quantennetzwerke über das QTF-Backbone:
- Partner
- Testbeds
Testbeds:
- LMU-MPQ: In Vorbereitung, 29 km
- Ulm: In Vorbereitung
- Stuttgart: Verschränkte Photonen, 35 km
- KIT: In Vorbereitung, 22 km
- Saarbrücken: Speicher-Photon-Verschränkung, 14 km
- LUH-PTB: Einzelphotonen, 73 km
- Paderborn: In Vorbereitung, 4 km
- Berlin: Verschiedene Verbindungen; verschränkte Photonen, 4 – 47 km
Die im Verbundprojekt betriebenen Testbeds dienen als praxisnahe Plattformen, um zentrale Komponenten und Verfahren der Quantenkommunikation außerhalb geschützter Laborbedingungen zu erproben. Jede dieser Strecken verfolgt dabei einen eigenen technologischen Schwerpunkt und trägt auf unterschiedliche Weise zum gemeinsamen Ziel bei: den Weg zu stabilen, skalierbaren Quantennetzwerken in Deutschland zu ebnen. Im Folgenden stellen wir die Teststrecken im Detail vor.
Saarbrücken Quantum Communication Fiber Testbed
Im Rahmen der Erforschung verteilter Quantennetzwerke wurde zwischen der Universität des Saarlandes (UdS) und der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW) eine 14,4 km lange urbane Dunkelfaserstrecke als offenes Testbed etabliert.
Auf der UdS-Seite befinden sich drei spezialisierte Labore: eines mit einem 40Ca+-Ion-basierten Quantenspeicher sowie einer SPDC‑Photonenpaarquelle jeweils mit einer Systemwellenlänge von 854 nm, ein weiteres mit einem Quantenspeicher auf Grundlage eines Zinn-Fehlstellen‑Zentrums in Diamant (619 nm) sowie ein Labor zur Frequenzkonversion der jeweiligen Photonen zu einer gemeinsamen Wellenlänge von 1550 nm (Telekom-C-Band). Als gemeinsame hochstabile Frequenzreferenz für alle Anregungs- und Konversionslaser steht ein Frequenzkammsystem zur Verfügung.
Die Faserstrecke zur HTW verläuft teils oberirdisch entlang von Hochspannungsleitungen (1,2 km) und teils unterirdisch durch mehrere Patch‑Stationen in Saarbrücken, wobei die Gesamtdämpfung ca. 11 dB beträgt. Für Experimente stehen zwei Dark‑Fiber‑Stränge zur Verfügung, einer für Quantensignale, der andere für klassische Synchronisations‑ und Steuerdaten. Alternativ können die beiden Fasern zu einem 29 km langen Ring zusammengeschlossen werden.
Am HTW-Standort befindet sich ein Serverraum, in dem die komplette Detektions‑ und Stabilisierungstechnik in einem Standard-19-Zoll-Rack untergebracht ist. Zur Detektion werden supraleitenden Nanodraht‑Detektoren (SNSPDs) mit einer Einzelphotoneneffizienz größer 80 % verwendet.
Die Qubits können entweder Time-Bin- oder polarisationskodiert werden. Der für die Time-Bin-Kodierung kritische Weglängendrift ist temperaturabhängig und zyklisch im Tagesverlauf. Er beträgt maximal 0,8 ns pro Tag. Zur Kompensation zeitabhängiger Polarisationsdrifts kommt ebenfalls ein aktives Stabilisierungssystem zum Einsatz, das durchschnittliche Prozessfidelitäten ≥ 99 % gewährleistet. Auf dieser Infrastruktur wurden bereits mit der SPDC-Quelle erzeugte Photon‑Photon und Ion‑Photon Verschränkung verteilt, sowie die Teleportation eines Qubit‑Zustands vom Ionenquantenspeicher auf ein entferntes Telekom‑Photon demonstriert. Damit bietet das Testbed eine praxisnahe Infrastruktur für Quantenkommunikationsexperimente und ermöglicht umfassende Validierungsstudien sowie Untersuchungen der Systeminteroperabilität in einer urbanen Glasfaserumgebung.

Quellennachweis: Kucera, S., Haen, C., Arenskötter, E. et al. Demonstration of quantum network protocols over a 14-km urban fiber link. npj Quantum Inf 10, 88 (2024). https://doi.org/10.1038/s41534-024-00886-x.
Stuttgart Quantum Communication Fiber Testbed
Das Stuttgart Quantum Communication Fiber Testbed verbindet mehrere Standorte auf dem Vaihinger Campus der Universität Stuttgart mit dem Gelände der Deutschen Telekom AG in Feuerbach. Das Netzwerk bildet eine 35,8 km lange Glasfaserschleife und nutzt zwei Dark-Fiber-Verbindungen, die durch das Stuttgarter Stadtzentrum verlaufen. Die gesamte Übertragungsverlust beträgt 14,4 dB.
Erste Experimente zeigten, dass die Polarisationverschränkung von Photonen über die gesamte Schleife erfolgreich erhalten blieb (DOI: 10.1364/OPTICAQ.530838). Dies bildet die Grundlage für zukünftige Anwendungen der Quantenkommunikation unter realen Bedingungen.

Wiedergabe mit Genehmigung nach Strobel et al., „High-fidelity distribution of triggered polarization-entangled telecom photons via a 36 km intra-city fiber network“, Optica Quantum 2, 274–281 (2024), lizenziert unter CC BY 4.0.
Karlsruhe Quantum Communication Fiber Testbed
Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wurde ein Testbed für Quantenkommunikation eingerichtet, das mehrere Labore auf dem Campus Süd und dem Campus Nord miteinander verbindet. Dafür wurde ein Paar verlegter Dark-Fiber-Leitungen mit einer Länge von 22 km von einem Telekommunikationsanbieter angemietet.
Im ersten Schritt konnte CV-QKD erfolgreich demonstriert werden. In der nächsten Projektphase sollen frequenzkonvertierte Einzelphotonen aus Farbzentren in Diamant übertragen sowie Spin-Photonen- und schließlich Spin-Spin-Verschränkung über die Verbindung demonstriert werden.

Berlin Quantum Communication Fiber Testbed
Das Berliner DT F&E-Testnetz stellt eine umfassende und aktiv betriebene Infrastruktur für Forschung und Entwicklung im Bereich der Quantenkommunikation bereit. Es verbindet mehrere Standorte in und um Berlin über unterirdische Singlemode-Glasfaserverbindungen und ermöglicht damit realitätsnahe Tests und Demonstrationen.
Der zentrale Zugangspunkt zum Testbed befindet sich im Quanten-Labor der T-Labs, der Forschungseinheit der Deutschen Telekom AG, in der Winterfeldtstraße in Berlin. Dieses Labor ist auf Computing, Netzwerkdiagnose und -automatisierung spezialisiert und bietet optimale Rahmenbedingungen für experimentelle Aufbauten. Vor Ort stehen verschiedene Glasfaserschleifen, terminierte Glasfaserverbindungen sowie dedizierter Rack-Platz für Nutzersysteme zur Verfügung. Die kontrollierte Umgebung mit konstanter Raumtemperatur von 25 °C ermöglicht stabile und reproduzierbare Experimentierbedingungen.
Die Streckeninfrastruktur unterstützt ein breites Wellenlängenspektrum von der O-Band (1310 nm) bis zur C-Band (1550 nm). Aktive Glasfaserverbindungen erschließen verschiedene Berliner Einrichtungen:
- T-Labs – Französische Straße: ca. 10,4 km, 6 Links / 12 Fasern, SMF, ~ 2,8 dB
- T-Labs – Dottistraße: 13,8 km, SMF, ~ 4,5 dB
- T-Labs – Humboldt-Universität Campus Adlershof: 25,7 km, 6 Links / 12 Fasern, SMF, ~ 8,9 dB
- T-Labs – ERP: 8,5 km, SMF, ~ 4,1 dB
- T-Labs – Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut: 4,4 km, 10 Links / 20 Fasern, SMF
- T-Labs – Strausberg: 47,3 km, 4 Links / 8 Fasern, SMF, ~ 14,5 dB
- T-Labs – Bundesdruckerei: 3,8 km, 6 Links / 12 Fasern, SMF
Ergänzend sind bei Bedarf auch Verbindungen mit einer Länge von mehreren hundert Kilometern verfügbar, etwa zur Validierung verteilter Systeme oder zur Erprobung von Quantenrepeater-Architekturen.
Diese einzigartige Netzinfrastruktur erlaubt es Nutzer:innen aus Forschung und Industrie, neue Systeme und Protokolle in einem urbanen, realitätsnahen Umfeld zu testen.

Niedersachsen Quantum Link
Der Niedersachsen Quantum Link ist ein Plug-and-Play-Testbed zwischen Hannover und Braunschweig. Das Testbed besteht aus zwei unterirdischen Singlemode-Glasfasern mit einem Zugangspunkt an der Leibniz Universität Hannover (LUH) und dem anderen an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. Die optische Distanz zwischen den beiden Punkten beträgt etwa 79 km.
Eine der Glasfasern wird derzeit für die Übertragung von Quantensignalen genutzt, bei einem Dämpfungsverlust von rund 21,0 dB. Die zweite Faser ist für die Übertragung von Zeit- und Frequenzsignalen vorbereitet, um eine Synchronisation der Knotenpunkte im Testbed zu ermöglichen.

Quellennachweis: Light Sci Appl 13, 150 (2024).
Ludwig-Maximilians-Universität München
In einer Kollaboration der Arbeitsgruppen von Prof. Dr. Gerhard Rempe am Max-Planck-Institut für Quantenoptik und Prof. Dr. Harald Weinfurter an der Ludwig-Maximilians-Universität wird in der Metropolregion von München eine Quantenstrecke aufgebaut. Geplant ist, einzelne photonische Quantenbits zwischen zwei Einzelatomen über eine 23 km lange optische Faser auszutauschen. Die Verschränkung des Photons mit dem emittierenden Atom soll dabei auf das Zielatom übertragen werden, wobei die erfolgreiche Verschränkung der zwei Atome durch die Erzeugung eines weiteren Photons am Ziel angekündigt wird. In weiterführenden Experimenten steht die Verschränkung der beiden Atome dann als Ressource zur Verfügung.

Quantenkommunikartions-Teststrecke Ulm
Die Ulmer Quantenkommmunikations-Teststrecke verbindet wissenschaftliche Einrichtungen auf dem Ulmer Eselsberg zwischen der Universität Ulm, dem Universitätsklinikum und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Für den Ausbau in Richtung eines städtischen Quantennetzwerkes ist eine Glasfaserverbindung in die Ulmer Innenstadt in Vorbereitung. Erste Tests auf der Basis kommerzieller QKD-Systeme wurden durchgeführt, wobei der Schwerpunkt auf Forschung und Anwendungen in der Informatik (IT-Sicherheit) und Medizin liegt. Die physikalische Grundlagenforschung wird durch die Anbindung von Quantennetzwerk- und Quantenrepeaterknoten aus den Laboren akademischer Arbeitsgruppen ausgebaut.